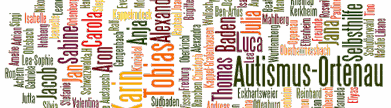Manche Fragen tauchen immer wieder auf – im Alltag, bei Gesprächen oder wenn es um Formalitäten geht. Wir haben für Dich die am häufigsten gestellten Fragen (FAQs – Frequently Asked Questions) rund um Autismus gesammelt – kurz und verständlich beantwortet.
Egal, ob es um Schule, den Alltag, Fördermöglichkeiten oder die ersten Schritte nach einer Diagnose geht: Hier findest Du schnelle Antworten, die Dir wirklich weiterhelfen.
Schau einfach mal rein – vielleicht ist genau Deine Frage schon dabei!
Die wichtigsten Fragen und Antworten
Autismus (von altgriechisch αὐτός autós „selbst“) ist eine angeborene Störung der
neuronalen Entwicklung. Erste Symptome zeigen sich bereits in frühester Kindheit,
insbesondere in folgenden Bereichen:
• Schwierigkeiten bei der sozialen Interaktion (z. B. Verständnis und Aufbau von
Beziehungen);
• Auffälligkeiten bei der sprachlichen und nonverbalen Kommunikation (z.B. Blickkontakt und Körpersprache);
• eingeschränkte Interessen mit sich wiederholenden, stereotypen Verhaltensweisen;
• Über- oder Unterempfindlichkeit auf äußere und innere Sinnesreize.
In Deutschland werden Diagnosen i.d.R. erst ab drei Lebensjahren anerkannt. Eine pauschale Aussage kann dazu nicht gegeben werden. Manche Kinder fallen bereits als Kleinkind auf, so dass früh eine Diagnostik beginnen kann.
Bei anderen Autistinnen und Autisten tritt der Autismus mit seinen Besonderheiten und Herausforderungen erst später auf, zum Beispiel im Schulalter, manchmal auch erst im Erwachsenenalter.
Eine Autismus Diagnose stellt in der Regel ein Psychiater:in sowie Fachärzte für Psychotherapie für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Gerne geben wir Mitgliedern unserer Selbsthilfegruppe bei Bedarf Hilfestellung.
Da Autismus nicht mit einer Blutabnahme oder ähnlichem nachgewiesen werden kann, also keine verlässlichen, messbaren biologischen Parameter bekannt sind, führt eine Beobachtung der Symptomatik zur Diagnose. Dafür finden mehrere Termine statt, bei denen das Verhalten systematisch beobachtet und meist die Eltern und/oder enge Bezugspersonen ausführlich zur bisherigen Entwicklung, zur momentanen Lebenssituation, zu familiären Gesundheitsrisiken und der bereits erfolgten Förderung befragt werden. Meistens kommen dabei mehrere aufwendige standardisierte Fragebögen zum Einsatz.
Lange Zeit hat man in frühkindlichen, atypischen und Asperger Autismus unterschieden. Heutzutage wird allgemein nur noch von ASS also der Autismus Spektrums Störung gesprochen. Je nach Ausprägung ist die betroffene Person mehr oder weniger davon betroffen.
Nein. Manche sprechen sehr früh und viel, andere gar nicht. Sprache entwickelt sich sehr unterschiedlich.
Für sie ist Blickkontakt oft anstrengend oder unangenehm.
Autismus bedeutet, dass Informationen und Reize vom Gehirn anders aufgenommen, verarbeitet und miteinander verknüpft werden. Diese andere Art und Weise der Wahrnehmung bedingt ein manchmal spezielles Verhalten, eine besondere Weise der Kommunikation und einen anderen Umgang mit Emotionen.
Zum Beispiel können sie sehr empfindlich gegenüber bestimmten Geräuschen und Stimmen sein und müssen sich die Ohren zuhalten, oder sie halten das Gefühl, das ein bestimmtes Kleidungsstück auf der Haut erzeugt, nicht aus, oder sie können den Geschmack einer bestimmten Speise nicht ertragen. Diese Reize werden als sehr unangenehm und manchmal sogar als schmerzhaft empfunden. Deshalb versuchen die Betroffenen diese Wahrnehmungen möglichst zu vermeiden oder aus Situationen, in denen sie den störenden Reizen ausgesetzt sind, zu flüchten.
oder
Manchmal nehmen Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung bestimmte Reize auch weniger intensiv wahr. Zum Beispiel kommt es vor, dass körperliche Schmerzen oder Kälte nicht so stark gespürt werden. Die Betroffenen brauchen dann oft besonders starke Reize, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen und suchen auch gezielt nach diesen.
Dazu zählen zum Beispiel das Zuführen von strengen Gerüchen, Nahrungsmittel mit intensivem Geschmack (auch nicht zum Verzehr geeignete Dinge, wie Sand oder Knetmasse), das Erzeugen von schnellen und rotierenden Bewegungen wie Schaukeln und Hüpfen, oder das Befühlen von rauen Oberflächen.
Ja! Sie fühlen genauso wie andere, zeigen es aber manchmal auf andere Weise. Das kann für fremde oft irritierend sein.
Durch klare Strukturen, Verständnis, spezielle Therapien und individuelle Betreuung.
Mit Geduld, klaren Strukturen, einfachen Anweisungen und viel Verständnis.
Routinen geben Sicherheit. Veränderungen können Angst oder Stress auslösen.
Ja, aber oft auf ihre eigene Weise. Freundschaften sehen manchmal anders aus, das ist für Außenstehende oft irritierend.
Sehr wichtig. Je früher passende Unterstützung beginnt, desto besser können sich Kinder entwickeln.
Über Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen, Autismus Therapiezentren und Fachleute.
Therapien im Bereich Autismus haben meistens das Ziel, soziale Teilhabe zu fördern und/oder einzelne funktionelle Fertigkeiten aufzubauen. Welche Aspekte im Vordergrund stehen, ist individuell verschieden und wird entsprechend besprochen und angepasst. Meistens greifen mehrere Professionen ineinander, so dass verschiedene TherapeutInnen mit dem Autisten bzw. der Autistin arbeiten. Niemals hat oder sollte eine (Autismus-)Therapie das Ziel haben, einen nichtautistischen Menschen zu formen bzw. Autismus „zu heilen“ (ist nicht möglich).
Im Unterschied zu anderen Therapieformen wie Ergotherapie und Psychotherapie ist eine Autismus Therapie keine Krankenkassenleistung. Sie wird als Teilhabeleistung über die Eingliederungshilfe beim zuständigen Jugend- oder Eingliederungshilfeträger beantragt.
Oft gibt es Leistungsvereinbarungen zwischen der Eingliederungshilfe und regionalen Therapeuten/Autismus Therapie Zentren. Mit einem Persönlichen Budget hat man jedoch die Möglichkeit, sich den Therapeuten auswählen, zu dem man das meiste Vertrauen hat und mit dem man gerne die Therapie machen will. Die Abrechnung eines solchen Therapeuten, der also keine Leistungsvereinbarung mit dem Amt hat, kann über das persönliche Budget finanziert werden. Mit dem Persönlichen Budget erhalten also Menschen mit Behinderungen oder deren Bevollmächtigte die finanzielle Freiheit, ihre Unterstützungsleistungen selbst zu organisieren.
Welche Behandlungsmethoden infrage kommen, hängt von der individuellen Situation ab. Am häufigsten sind Verhaltenstherapie, Elterntraining, Logopädie, alltagspraktische Anleitung. Bei einigen Menschen kann auch eine medikamentöse Behandlung helfen. Man sieht es gibt ein sehr breites Spektrum an Therapien und ebenso gibt es eine Vielzahl von an Anbietern auf dem Markt. Was zu wem passt, muss jeder für sich selbst entscheiden.
Autismus ist nach aktuellem Wissensstand nicht heilbar. Bestimmte Problematiken können im Verlauf von Lebensphasen unterschiedlich stark oder auch weniger in den Vordergrund treten. Viele Autistinnen und Autisten entwickeln Strategien, um mit den Anforderungen des Alltags zurechtzukommen, so dass sie weniger auffallen. Auch Therapien und das Anpassen von Rahmenbedingungen können die Lebensqualität verbessern.
Autismus wird nicht als Krankheit bezeichnet, sondern als neurologische Entwicklungsstörung, die von Geburt an besteht und sich in verschiedenen Ausprägungen zeigt. Da Autismus keine Krankheit ist, werden auch keine Leistungen von der Krankenkasse bezahlt.
Das Autismus-Spektrum ist sehr groß und vielfältig. Die Erscheinungsformen bringen
verschiedene Herausforderungen mit sich. Man sagt „Kennst du einen Autisten, so kennst du EINEN Autisten!“
Das persönliche Empfinden von Autistinnen und Autisten in Bezug auf eine Behinderung variiert entsprechend. Einige lehnen den Begriff Behinderung ab, andere fühlen sich durch die Gesellschaft behindert, wiederum andere empfinden die Besonderheiten ihrer autistischen Wahrnehmung per se als Behinderung. Autismus kann in seinen Auswirkungen also eine Behinderung sein. Damit können Autisten gemäß Sozialgesetzbuch einen Behindertenausweis beantragen und erhalten so Unterstützung vom Staat.
Ein Schwerbehindertenausweis ist ein in Deutschland bundeseinheitlicher Nachweis über den Status als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung (GdB) und weitere gesundheitliche Merkmale, die Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Rechten und Nachteilsausgleichen sind. Der Ausweis wird vom Versorgungsamt bzw. einer anderen zuständigen Behörde auf Antrag ausgestellt. Ein Ausweis wird erst ab einem festgestellten Grad der Behinderung (GdB) von wenigstens 50 ausgestellt.
Menschen mit Schwerbehinderung können Nachteilsausgleiche bekommen. Zum Beispiel Vergünstigungen bei der Steuer, mehr Urlaubstage oder niedrigere Eintrittspreise bei Kultur-Veranstaltungen.
Der Grund dafür: Menschen mit Behinderung haben in ihrem Alltag oft höhere Kosten. So müssen sie zum Beispiel mehr Geld für Medikamente, Hilfsmittel oder Pflege ausgeben. Um diesen und andere Nachteile zumindest etwas auszugleichen, gibt es die Nachteilsausgleiche. Für viele Nachteilsausgleiche brauchst Du einen Schwerbehinderten-Ausweis.
Um einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen, sollten folgende Schritte beachtet werden.
• Antrag einreichen: Der Antrag muss beim zuständigen Versorgungsamt des Landratsamts am Hauptwohnsitz des Antragstellers eingereicht werden.
• GdB ermitteln: Stelle sicher, dass Du einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 hast, um Anspruch auf den Ausweis zu haben.
• Dokumente einreichen: Reiche alle aktuellen medizinischen Unterlagen und Nachweise über Deine Behinderung ein.
• Bearbeitungszeit: Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel drei bis sechs Monate.
• Gültigkeit des Ausweises: Der Ausweis ist grundsätzlich für maximal fünf Jahre gültig, kann aber bei unveränderlicher Behinderung auch unbefristet ausgestellt werden.
Wir unterstützen in unserem Netzwerk gerne durch unser Wissen und unsere Erfahrungen.
Die Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis sind spezielle Kennzeichnungen, die auf der Rückseite des Ausweises zu finden sind. Sie geben Auskunft über die Art und Schwere der Behinderung und ermöglichen den Betroffenen verschiedene Vorteile. Zu den häufigsten Merkzeichen gehören:
• G: Gehbehindert – für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
• B: Begleitperson erforderlich – für Menschen, die auf eine Begleitperson angewiesen sind.
• H: Hilflos – für Personen, die in ihrem Alltag auf Hilfe angewiesen sind.
• aG: Außergewöhnlich gehbehindert – für Personen mit sehr starken Einschränkungen in der Mobilität.
• Bl: Blind – für Menschen, die blind sind oder stark sehbehindert.
• Gl: Gehörlos – für Personen, die gehörlos sind oder stark hörbehindert.
• TBl: Taubblind – für Menschen, die sowohl taub als auch blind sind.
• RF: Rundfunkgebührenbefreiung – für Personen, die von der Rundfunkgebührenpflicht befreit sind.
Die Merkzeichen ermöglichen verschiedene Nachteilsausgleiche, z.B.
• Steuererleichterungen: Menschen mit bestimmten Merkzeichen können von Steuervergünstigungen profitieren.
• Kostenlose Beförderung: In vielen Verkehrsmitteln haben sie Anspruch auf kostenlose oder ermäßigte Fahrkarten.
• Ermäßigungen: Viele Einrichtungen, wie Museen oder Freizeitparks, bieten ermäßigte Eintrittspreise für Menschen mit Schwerbehindertenausweis an.
Diese Merkzeichen sind wichtig, um die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen und ihnen den Alltag zu erleichtern.
Auf Antrag wird beim Versorgungsamt ein Beiblatt zum Ausweis ausgestellt, wenn die Voraussetzungen für die unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr vorliegen. Der schwerbehinderte Mensch kann dann entweder die unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr oder die Kraftfahrzeugsteuerermäßigung in Anspruch nehmen. Für die unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr ist zusätzlich eine Wertmarke erforderlich. Wenn das Merkzeichen „H“, „Bl“ oder „aG“ vorliegt, kann sowohl die unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr als auch die Kraftfahrzeugsteuerbefreiung in Anspruch genommen werden.
Ein Behindertentestament ist ein spezielles Testament für Eltern oder Angehörige eines Menschen mit Behinderung. Es sorgt dafür, dass das Kind oder die erwachsene Person mit Behinderung gut versorgt ist – und dass das geerbte Vermögen nicht vollständig an den Staat oder an Sozialhilfeträger geht.
Ziel des Behindertentestaments
• Sicherung der Versorgung des Menschen mit Behinderung.
• Erhalt des Familienvermögens.
• Schutz vor dem direkten Zugriff durch Sozialhilfeträger.
Wie funktioniert es?
• Das Testament wird so gestaltet, dass die Person mit Behinderung zwar erbt, aber nicht frei über das gesamte Vermögen verfügen kann.
• Meist wird ein Testamentsvollstrecker eingesetzt. Er verwaltet das Erbe und nutzt es für das Wohl der behinderten Person.
• So bleibt das Vermögen geschützt und trotzdem für Extras (z. B. Freizeit, Hobbys, besondere Bedürfnisse) verfügbar.
Wichtige Hinweise
• Ein Behindertentestament sollte immer mit fachkundiger Hilfe (Notar oder Fachanwalt für Erbrecht) erstellt werden.
• Es ist eine sehr individuelle Regelung, die sich immer nach der jeweiligen Familiensituation richtet.
• Eine gute Beratung stellt sicher, dass das Testament wirksam und rechtlich sicher ist.
Wir unterstützen in unserem Netzwerk gerne durch unser Wissen und unsere Erfahrungen.